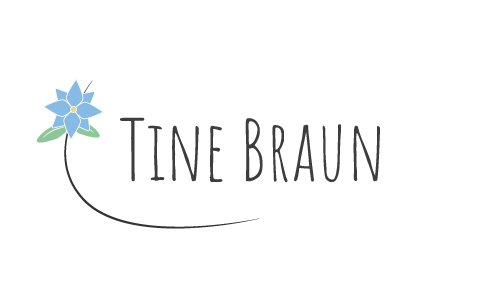Das Gesicht
Ist das wirklich alles? Geht es nun immer so weiter, so weiter, so weiter?
Bin ich hier, um in diesem Karussell zu sitzen, achtlos, träge, immer im Kreis herum. Durch einen unsichtbaren und doch spürbaren Lufttunnel, immer in der gleichen Spur und der Wind kommt immer von vorne oder, ich denke er käme vom vorne, obwohl die Luft steht. Ich schneide sie ab mit meinem Lufttunnel, schneide die Luft, die genauso träge ist, wie ich und die einfach alles mit sich machen lässt.
Und wenn dies alles nur ein Wunschtraum ist? Das Leben in einem Karussell zu verbringen ist nicht mal das schlechteste. Was bilde ich mir eigentlich ein?
Ich stelle mich am Morgen gerade hin und schrumpfe am Tag um knapp zwei Zentimeter. Ich stelle mich aufrecht und halte mich solange, bis endlich die Nacht alles verdunkelt und ich mir das Recht herausnehmen kann, umzufallen.
Für mich ist Schlafengehen die legitime Berechtigung umzukippen, die Standhaftigkeit aufzugeben oder zuzugeben, dass ich nicht nur schlafen will, sondern, dass ich aufgebe, für diesen Tag jedenfalls, jeden Abend.
Es gab in der letzten Zeit wenige Tage, an denen ich einfach nur schlafen ging.
In den Minuten, bevor ich des morgens die Augen öffne, entknote ich meinen Magen, der durch die heftigen Träume der Nacht umgestülpt wird, wie ein alter Socken. Ja, meine Träume schlagen mir mächtig auf den Magen, sie durchwühlen meine Eingeweide, quirlen Unverdautes mit Unverdautem durcheinander.
Ich öffne die Augen ungern, bevor ich den Magen beruhigt habe. Ich öffne sie langsam, vorsichtig. Der Tag liegt vor mir wie ein nasses Brett.
Was um Himmels Willen ist nur passiert?
Möglicherweise ging ich immer nur den leichten Weg und ließ mich auf nichts ein. Jetzt zahle ich den Preis.
Der leichte Weg ist unfruchtbar, und vom Nichts bleibt nichts übrig.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wüsste ich nicht, was. Die Farben sind stumpf.
Das Wort Bedürfnis ist mir fremd. Ich weiß nicht, was mir fehlt, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich liebe, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nichts. Nichts.
Und das, ist es das wirklich? Läuft das Karussell noch oder steht es längst im trägen Wind? Und dieses Stehen im trägen Wind, was ist es anderes als ein Fliegen im trägen Wind oder ein Laufen oder ein Fahren. Was ist der Unterschied und wenn es einen Unterschied gäbe, würde er für mich wichtig sein?
Auch heute Abend werde ich wieder umfallen, meine Beine werden kippen, meine Schultern hängen, meine Mundwinkel werden sich nach unten ziehen und Träume die Fahrtrichtung aufnehmen.
Lebe ich mehr in meinen Träumen oder mehr im Wachsein. Wann bin ich lebendig und bin ich überhaupt lebendig?
Ich wünsche mir einen lebendigen Traum für die heutige Nacht, einen guten, einen warmen. Denn Kälte ist nicht angenehm auf einem Karussell.
Ich sah das Gesicht zum ersten Mal, als ich gegen Mittag erwachte.
Die Woche war mir unbekannt, sie war eben, das reichte.
Wenn man wie ich keine Wünsche hat, ist ein Mittwoch wie ein Sonntag, und der Morgen unterscheidet sich vom Abend nur durch den Stand der Sonne. Morgens scheint sie mir recht früh ins Gesicht. Ich besitze keine Vorhänge, ich kann Gardinen nicht leiden. So nimmt sich die Sonne die Frechheit heraus, mir mitten ins Gesicht zu scheinen, gegen morgen, irgendwann, meist sehr früh.
Die Geräusche des Morgens sind mit denen des Abends identisch. Wenn die Nachbarkinder zur Schule schreien, schreien sie die gleichen Worte wie abends, immer dann, wenn sie vom Spielplatz kommen. Die Glocken der evangelischen Kirche läuten morgens um sechs und abends um sechs. Das muss für einige Menschen eine große Bedeutung haben. Wie ich schon sagte, für mich hat es keine Bedeutung.
Das dachte ich jedenfalls, bis ich das Gesicht zum ersten Mal sah.
Die Geräusche der Straße sind gleichbleibend widerlich. Oft denke ich an die Menschen von vor hundert Jahren, die ohne diesen Strassenkrach lebten. Ich stelle mir vor, wie sie in ihren Betten lagen, wie sie schlafen konnten, ohne Motorengeräusche, Hupen und Reifenquietschen. Vielleicht hörten sie ihren Atem oder das scharrende Warten der Spinne im Netz. Vielleicht hörten sie aber auch nichts. So wie ich durch die Geräusche des Tages nichts höre, ich höre nichts, jedenfalls nichts von Bedeutung.
Ich schlafe viel in den Tag hinein und wenn ich nicht schlafe, liege ich herum.
Ich entschied mich an solch einem Tages zu einem Stein zu werden. Ich bemühe mich. Der Gedanke an einen runden, schweren Stein macht mich weich und meine Augenlider flattern weniger.
Meine Familie hat mich verlassen. Sie verlassen mich jeden Morgen. Sie sind noch sehr davon besessen zu besitzen, zu holen, zu kaufen, zu sammeln und zu stapeln. Dafür braucht man Zeit und Geld und Arbeit und Menschen und Reden und Rennen und noch einmal Reden und wieder Reden. Und auch sie hören nichts von Bedeutung.
Meine Augen sind noch sehr unsteinig. Sie schauen noch umher und manchmal beobachten sie auch. Wenn ich sie dabei ertappe, schließe ich sie. Denn was gibt es schon zu beobachten. Was gibt es schon wirklich Bedeutendes?
So dachte ich. So denke ich. Immer noch, aber etwas weniger eisig.
Das Gesicht hat an diesem Morgen etwas Andächtiges, etwas leicht Flamingohaftes. Bessere Worte fallen mir nicht ein. Ich möchte denjenigen sehen, dem beim Anblick eines Gesichts am Morgen, die richtigen Worte einfallen.
Es ist eine Frau, das Gesicht. Das Gesicht ist das Gesicht einer Frau ohne Worte.
Noch niemals in meinem Leben hat das Gesicht einer Frau mit mir geredet, ohne etwas zu sagen.
Meine Familie hat keine Ahnung, dass in ihrem Haus, also in unserem Haus ein Gesicht lebt. Wobei ich nicht genau sagen kann, ob es lebt, aber ich vermute es.
Und was heißt schon leben. Sagt das Herumrennen von Männern, Frauen, Kinder etwas über Leben aus, oder ist es nicht eher ein Nichtleben?
Wenn ich nicht renne, dafür ein Gesicht sehe, das mit mir spricht, bedeutet dass dann, dass ich lebe und, was bedeutet das für das Gesicht? Oder bin ich tot und vermutlich für das Gesicht, auch nur ein Gesicht.
An diesem Morgen also, als das Blau des Zwischenlichts meine Augen noch verfärbte, schwebte das Gesicht über mir. Ich schaute es an, das Gesicht. Starrte mit meinen vom Zwischenlicht noch verfärbten Augen in die gleichen Augen. Die gleichen, also meine Augen, allerdings unverfärbt vom Zwischenlicht.
Starrte mir selbst in die Augen, die mich aus einem Gesicht betrachteten, das über mir schwebte.
Es dauerte eine Weile, bis das Blau des Zwischenlichts vom Gelbgold des herantrabenden Tages verwässert, meinem Blick, von hier nach dort, den Schleier wegriss. Mein Gesicht über mir atmete erleichtert aus und blinzelte mir zu.
Es liegt an dir, sagte es ohne Worte.