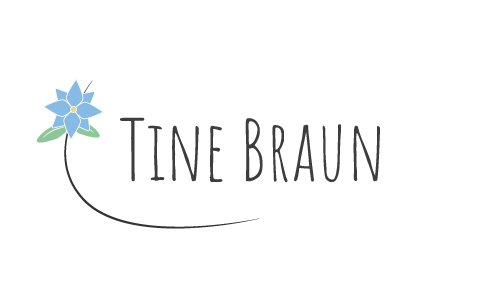Mein Gott…
Ich bin es. Theresa.
Warum ich hier sitze und schreibe?
Nun, ich bin ihr schon wieder begegnet.
Gerade eben, in der Unterführung zur Fußgängerzone.
Wirklich Leute, ich bin noch ziemlich von der Rolle. Zumal sie mit mir telepathiert hat, oder wie man das nennt.
Sie war es und ich bekomme Ganzkörpergänsehaut, wenn ich daran denke.
Ich erkannte sie sofort, bereits von Weitem erkannte ich sie.
Da war dieses Licht um sie herum, eher ein Glühen, bläulich, aber nicht ganz so glimmerig wie damals in Frankreich.
Jedoch deutlich zu erkennen, obwohl eher verdichtet, zusammengeballt und wie ein Schleier um sie herum oder eine Tarnkappe.
Komischerweise, oder auch nicht, bemerkten die Anderen wieder einmal, nichts.
Genau wie in Frankreich. Als hätten die Menschen keine Augen im Kopf.
Manchmal denke ich, die Leute um mich herum merken überhaupt nichts.
Die würden sogar den Papst umrennen, bei ihrem Tempo und der Hektik durch die Stadt.
Aber ich, ich erkannte sie sofort.
Wie angepflockt stand ich herum, nichts ging mehr. Es kam mir vor, als seien wir allein auf der Welt. In Wirklichkeit kam sie einfach auf mich zu.
Dann jedoch, als sie nahe genug herangekommen war, fielen ihre Augen in meine Augen.
Ich weiß, ich weiß, das hört sich an wie in einer Soap, oder in einem Kitschroman.
Es war jedoch genauso und ich kann es nicht anders beschreiben.
Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, meine Güte, ich würde mich für durchgeknallt halten. Echt, ich verstehe jeden, der in solch einem Fall denkt, er habe es mit einer Irren zu tun. Aber es ist die Wahrheit. Sie war es. Schon wieder.
Also, sie kam auf mich zu mit diesem weichen, federnden Gang. Ich sah sie schon von weitem, nein, ich ahnte sie, dachte an sie, bevor ich sie sah. Als ich den Kopf hob, fielen ihre Augen in meine Augen. Sie lächelte. Das ist so ein Lächeln, das kommt dir nicht oft entgegen. Bei so einer Art Lächeln hast du sofort das Gefühl, die kennt dich. So eine Art Lächeln, als ob man seit tausend Jahren miteinander durchs Leben geistert.
Kurz bevor sie an mir vorbeischwebte, hörte ich unsere Stimmen. Ich meine, ich hörte sie nicht wirklich, nein, sie waren in meinem Kopf. Als würden sie sich dort begegnen, während sie mit ihren Augen in meinen an mir vorbeirauschte und schon auf der Rolltreppe stand. Zwei Stimmen hintereinander, ihre und meine. „Hallo Theresa.“
„Hallo Maria.“
Ich schreibe das jetzt hier nicht umsonst auf. Es gibt niemanden mit dem ich darüber reden kann. Nicht einmal mit Tamina. Meine Mutter schon gar nicht. Vielleicht meine Oma, aber die wohnt in Berlin. Und am Telefon geht das nicht. Meinen Vater kann ich ganz vergessen. Der würde mich sofort zu einem Psychiater schicken. Letztendlich, da bin ich mir sicher, stände sofort der Verdacht auf dem Tisch, dass ich wieder mit dem Kiffen angefangen hätte. Habe ich aber nicht.
Ich habe sie wirklich gesehen. Und das war nicht das erste Mal.
Wenn ich so drüber nachdenke, sah sie in der Unterführung ganz schön krass aus. Die heilige Maria in durchlöcherten Jeans und schwarzem Lederjäckchen. Die Haare trug sie wie in Frankreich, Dunkel und lockig, fast bis zum Bauch. Die Augen, ja diese unglaublichen Augen strahlten, und sie waren blau, hellblau, irgendwie übermagisch.
In Lourdes, auf dem Parkplatz, trug sie einen blauen Umhang. Zuerst dachte ich, da steht ein Typ und pinkelt in die Hecke. So etwas macht mich sauer, aber hallo! Das geht gar nicht. In die Gegend pinkeln geht überhaupt nicht. Sauer wie ich war, wollte ich dem gerade die Meinung sagen. Da dreht sie sich um. Die Hecke hinter ihr war eher ein Baum, Holunder vielleicht. Jedenfalls trug er helle Blüten, wie kleine Schneeflocken. Sie lächelte mich an und ich blickte mich um, weil ich dachte, die Freude in ihrem Gesicht gilt jemandem hinter mir. Aber da war niemand. Auch kein Geräusch, kein Laut, als dehne sich die Zeit für eine Weile aus. Es gibt im Fernsehen solche Momente, da läuft dann alles verzehrt wie in Zeitlupe ab. Hier auf dem Parkplatz hinter dem Hotel geschah das auf ähnliche Weise. Außerdem und das war unglaublich schön, gab es in diesem Augenblick nur sie und mich auf der Welt. Es war nicht so, dass ich mich völlig ausgeklinkt hätte, ich wusste schon, dass meine Eltern und meine kleine Schwester gleich nebenan im Hotel im Frühstücksraum saßen und darauf warteten, dass ich die Kamera aus dem Wagen hole, aber das hatte für mich in diesem Moment keinerlei Bedeutung.
„Hallo Theresa“, sagte sie.
Echt, ich war noch niemals in meinem Leben sowas von sprachlos. Wer mich kennt, der weiß, dass das nicht so oft vorkommt. Wenn möglich diskutiere ich alles aus, wirklich alles. Leicht lasse ich mir nichts vormachen. Wenn ich etwas nicht verstehe, grabe ich solange nach, bis es klar ist oder die Diskussion beendet. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als Phrasen. Phrasen über das was man sollte oder nicht sollte, zum Beispiel. Da lasse ich nicht locker. Das muss für mich logisch sein, einen Sinn haben. Meine Mutter nennt mich manchmal penetrant. Da mag sie Recht haben.
Aber das hier vor dem Holunderbaum, das hier war etwas völlig anderes. Es fällt mir schwer es zu beschreiben. In diesem Augenblick war alles klar, logisch und sinnvoll. Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, ich würde niemandem glauben, der so etwas behauptet. Ich würde ihn auslachen. In meinen Augen könnte das nur ein Verrückter behaupten. Weil, ehrlich, wenn man sich die Welt so ansieht gibt es doch wohl nirgendwo etwas das überdimensional klar, logisch und sinnvoll ist und dazu gleichzeitig auf eine unbeschreibliche Weise voller Frieden.
In Lourdes ging schon am ersten Tag die Post ab. So viele Menschen auf der Suche. Die ganze Stadt besteht fast nur aus Kramläden. Überall kannst du Heilwasser kaufen. In Plastikflaschen in allen Größen. Marienstatuen, Rosenkränze, Heiligenbilder.
Bei mir lief da gar nichts.
Meine Eltern dagegen waren völlig von der Rolle. Mit meiner kleinen Schwester in der Mitte hetzten sie die Straße herunter bis zur Kirche. Die Frühmesse musste es sein und dann der Weg hinunter zur Grotte.
Ganz ehrlich, ich hielt mich bewusst zurück. Meine Mutter versuchte uns zusammen zu halten, aber ich hatte etwas völlig anderes im Kopf.
Schon nach ein paar Minuten schlug ich mich in eine Seitengasse.
Am Ende der kleinen Straße fand ich einen Buchladen. Ein Schild an der Tür sagte mir, dass der Laden geschlossen war, trotzdem drückte ich die Türklinke herunter, und schon stand ich in einem winzigen Raum.
An den Wänden hingen Heiligenbilder.
Jesus in allen Variationen, mit blauen Augen oder braunen. Von vorne den Betrachter durchdringend anschauend, so dass man schnell wegschauen muss, oder von der Seite mit inbrünstigem Blick Richtung Himmel.
Dazwischen Marienbilder, bis es einen schwindelte.
Und natürlich die Heilige Theresa, gemalt, fotografiert und gezeichnet.
Ich hatte mich schon wieder zum Ausgang hingewandt, da hörte ich ein Rascheln im hinteren Bereich des kleinen Verkaufsraumes.
Als ich mich umdrehte, sah ich eine alte Frau auf mich zukommen.
Sie kam mir bekannt vor, irgendwo hatte ich sie schon einmal gesehen, was ja eigentlich unmöglich war, und sie tat so, als habe sie auf mich gewartet.
Das war natürlich alles nur ein Gefühl und dauerte kaum Sekunden. In Wirklichkeit wollte sie mir wahrscheinlich nur irgendwelchen Heiligenkram verkaufen.
Ehe ich wusste wie mir geschah, drückte sie mir ein Buch in die Hand und als ich versuchte ihr zu erklären, dass ich nichts kaufen wolle, winkte sie ab und schob mich aus der Tür.
Augenblicklich wurde ich von einem Pulk Pilgern Richtung Kathedrale geschoben. Da hatte ich nun aber wirklich keine Lust drauf. Rasch kehrte ich um und rannte im Laufschritt die Straße zurück in der Hoffnung, unser Hotel wiederzufinden.
Nach einer halben Stunde hatte ich es geschafft und fiel im Hotelzimmer völlig außer Atem auf das Doppelbett, das ich mir mit meiner kleinen Schwester teilte.
Das Buch aus dem kleinen Laden hielt ich immer noch fest in meiner Hand.
Ich musste eingeschlafen sein, denn plötzlich saß meine kleine Schwester auf meinem Rücken und versuchte mir das Buch aus der Hand zu zerren.
Das Buch.
Nein, es war kein heiliges Buch, oder die Geschichte der Heiligen Theresa. Auch keine Bibel oder ein Reiseführer über Lourdes und seine Umgebung. Es war eine Art Tagebuch, eine Kladde mit leeren Seiten. Eher wie ein Schulheft, aber gebunden und mit einem schönen samtenen Lesezeichen.
Irgendwie war ich enttäuscht. Oder vielleicht nicht enttäuscht, sondern verärgert. Ja, tatsächlich, wenn ich daran zurückdenke, war ich sauer auf die alte Frau. Ich hatte etwas Sensationelleres erwartet.
Sie hatte mir ein Tagebuch in die Hand gedrückt. Ein Tagebuch, meine Güte, als wäre ich gerade einmal zwölf. Denn, ganz ehrlich, wer schreibt mit siebzehn noch Tagebuch?
Den kurzen Impuls das Buch meiner Schwester zu schenken, unterdrückte ich allerdings, sondern packte das Buch zwischen die T-Shirts in meine Reisetasche.
Nach dem Abendessen verzog ich mich ins Zimmer, während meine Familie noch einige Zeit mit anderen Pilgern im Speisesaal verbrachte. Das ganze Gerede über all die Gefühle und spirituellen Erlebnisse meiner Eltern und hier besonders meiner Mutter ging mir auf die Nerven. Immer muss sie alles analysieren und bewerten. Wer will das schon.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen schickte sie mich dann zu unserem Wagen, der hinter dem Hotel auf dem Parkplatz stand, um die Kamera zu holen. Die hatten sie am Abend dort vergessen. Na, ja und was mir dort auf dem Parkplatz passierte, habe ich ja schon erzählt.
Meinen Eltern gegenüber habe ich geschwiegen wie ein Grab. Wie ich schon sagte, das Risiko schnurstracks wieder bei irgendeinem Therapeuten zu landen, war mir zu groß.
Nach drei Tagen Lourdes war der ganze Spuk vorbei und wir wieder auf der Autobahn Richtung Deutschland.
Ganz ehrlich, nach ein paar Tagen hatte ich das Ganze so gut wie verdrängt. Bloß nicht weiter drüber nachdenken, sagte ich mir, vielleicht ist ja doch in deinem Kopf nicht alles so, wie es sein sollte.
Und heute dann, kam ich aus der Schule und wollte so schnell wie möglich bei „Burger“ etwas essen. Mit einem Mal kam sie mir in der Unterführung entgegen, und wir begrüßten uns ohne Worte wie alte Freunde.
Ich musste eine Weile wie weggetreten sein, stand also den Leuten im Weg herum und wurde schließlich von einem deftigen Rempler wieder in die Realität gecrashed.
„Was war das, dachte ich, und wusste ihm selben Moment, dass ich sie einholen musste, sie suchen musste. Da war so ein unglaublich innerer Drang. Mobbing, dachte ich noch, und dass mich da jemand kirre machen will.
Trotzdem machte ich kehrt und rannte hinter ihr her.
Irgendwie zog es mich Richtung Stadtpark. Wie ferngesteuert, echt. Also Richtung Stadtpark und dort hinunter zum Kinderspielplatz.
Tja, und dort saß sie. Ich sah sie schon von weitem. Dieses komische Flimmern um sie herum. Als drehe sich das Licht der Sonne in die falsche Richtung.
Sie winkte mir zu, als habe sie auf mich gewartet. Hört sich verrückt an und war wieder nur so ein Gefühl, aber dann sagte sie es auch.
„Hallo Theresa, ich habe schon auf dich gewartet.“
Ich verstand nur Bahnhof und setzte mich erst einmal neben sie.
Da nahm sie meine Hand.
Ihr könnt mir glauben, noch niemals in meinem Leben hat mich solch ein Gefühl durchströmt. Also, wenn meine Mutter mir so etwas erzählt hätte, ich wäre kopfschüttelnd und augenrollend aus der Küche gelaufen.
Es war wie ein warmes Bad von innen. Wie nach einem Wodka Tonic, aber tausendfach potenziert.
Dabei hielt sie nur meine Hand in ihrer und schaute mich an. Wenn auf dem Spielplatz nicht so viele Kinder getobt hätten, wäre ich auf die Knie gefallen. Vor ihr, also vor Maria in ihren durchlöcherten Jeans und dem, ganz ehrlich, ziemlich geschmacklosen Lederjäckchen.
Plötzlich lachte sie los und ich kam mir ziemlich albern vor. Der ganze religiöse Spuk löste sich auf, Gott sei Dank.
„Woher kennst du mich eigentlich“, fragte ich sie und rückte etwas von ihr ab.
„Ich kenne dich seit tausend Jahren, weißt du das nicht.“
Augenblicklich kam mir etwas in Erinnerung und für einen kurzen Moment fiel ich in ein Gefühl wie nach einem Superjoint, oder nach noch etwas Besserem. Es gelang mir nicht, die Erinnerung zu halten, aber ich fühlte, dass sie Recht hatte, und dass das, was sich hier gerade abspielte genauso normal war, wie meine Vier in Mathe.
„Bist du die, von der ich denke, dass du es bist?“ fragte ich sie und wusste nicht welche Antwort mir lieber war.
„Du meinst, die heilige Maria? Ja, das bin ich. Das bin ich schon seit so unglaublich vielen Jahren. Nur jetzt, in dieser Zeit, ist das alles nicht mehr so einfach. Ich brauche Hilfe. Stell dir vor, die Leute auf der Straße, oder was noch schlimmer wäre, die Polizei würde herausbekommen, wer ich bin, was glaubst du, was dann passiert.
„Das würde keiner glauben, da bin ich mir sicher, Maria, wer würde das denn glauben.“
„Genau. Und das ist mein Problem, denn ich habe schließlich einen Auftrag zu erfüllen. Stattdessen muss ich achtgeben, dass ich nicht in der Psychiatrie, oder was noch schlimmer wäre, in irgendeiner Talkshow lande.“
Marie senkte den Kopf und faltete die Hände im Schoss. Ganz nebenbei bemerkt, waren ihre Fingernägel ziemlich abgeknabbert, was mich etwas irritierte, gerade weil sie in Lourdes so überirdisch schön ausgesehen hatte.
„Was meinst du mit Auftrag“, fragte ich.
„Darüber kann ich jetzt noch nicht sprechen, zumal…“ und dann winkte sie mit beiden Händen und bekam ganz rote Ohren, „zumal mein Freund dort gerade kommt.“
Als ich mich umschaute, stapfte ein dunkelhaariger Bär mitten über die Wiese auf uns zu. Vertrauenswürdig sah der nicht aus und, ich würde mal sagen, sicherlich schon über dreißig.
Je näher er kam, umso kleiner wurde er und als er schließlich vor mir stand, war er mal eben einen halben Kopf größer als ich. Aber seine Stimme, Leute, solche eine Stimme habe ich noch nie gehört. Zum hineinfallen. Und auch er schien es für das Normalste der Welt zu halten, dass Maria, die heilige Maria wohlgemerkt, hier mit mir auf einer Bank im Stadtpark saß.
Als wäre das das Normalste der Welt begrüßte er mich auf diese lustige französische Art, Küsschen links, Küsschen rechts.
Mir wurde ganz anders.
„Hey Theresa“, sagte er und ich wunderte mich über nichts mehr.
„Das ist Jo“, sagte Maria.
Jo lächelte ein schräges Lächeln, und hatte sofort mein Herz gewonnen.
„Hört mal, ihr beiden, ich habe nicht viel Zeit“, sagte er, „die Mittagspause ist verdammt kurz. Außerdem muss ich noch auf die Bank. Ich wollte euch vorschlagen, dass wir uns in zwei Stunden im „Havanna“ treffen. Dann können wir in Ruhe reden.“
Er wippte von einem Bein auf das andere und machte mich ziemlich nervös.
Mein Bus zurück nach Hause war längst abgefahren und mir war klar, dass meine Mutter sich fürchterlich aufregen würde, wenn ich zu spät käme.
Nichtsdestotrotz wollte ich hier nicht weg, oder vielmehr, ich konnte hier nicht weg.
Tief in meinem Bauch fühlte ich, das Wichtiges, ja das überirdisch Wichtiges passierte. Allerdings hatte ich keine Ahnung, was das ausgerechnet mit mir zu tun hatte.
„Leute“, warf ich ein, „so einfach geht das bei mir nicht. Meine Mutter wird einen Heidenaufstand machen, wenn ich nicht bald nach Hause komme. Ich muss mich wenigstens kurz dort sehen lassen und einen Grund erfinden, warum ich noch einmal zurück in die Stadt will.“
Beide sahen sich an. Dann nickte Jo und legte seine Hand auf meine Schulter. Das war der Moment, in dem alles was mir vorher in meinem Leben wichtig war, dahinschmolz wie Schneematsch in der Sonne. In meinen Ohren knackte es und mein Herz machte mehrere Purzelbäume. Dann wurde es sehr still, als bliebe die Zeit stehen.
Tat sie aber nicht.
„Okay“, sagte Jo, „ich bringe dich zur Haltestelle am Rathaus, dann kriegst du deinen Bus noch. Wir sehen uns dann gegen fünf im „Havanna.“
Maria nickte und nahm mich schnell in den Arm.
„Bis später“, flüsterte sie, „ich bin so froh, dass ich dich wiedergefunden habe.“
Das glaubt mir kein Mensch, dachte ich und fühlte mich ziemlich wie durch den Wind.
Jo schnappte nach meiner Hand. Zusammen hetzten wir zum nächsten Taxistand. Ehe ich Luft holen konnte, saß ich neben diesem Mann, den ich erst ein paar Minuten kannte auf dem Rücksitz des Taxis und wagte kaum ihn anzuschauen.
„Was passiert hier?“ flüsterte ich.
Jo seufzte und rückte ein wenig näher.
Der Taxifahrer nahm uns im Rückspiegel ins Visier. Was der sich wohl dachte?
„Das gleiche wie vor 2000 Jahren“, flüsterte Jo zurück, „es ist wieder an der Zeit.“
„Aber was habe ich damit zu tun?“
So langsam überstieg das Ganze mein Fassungsvermögen.
Jo lehnte sich zurück und seufzte.
„Wir haben es damals irgendwie verbockt. Erinnere dich, diese verdammte Volkszählung mit dem ganzen Stress. Nirgendwo ein Zimmer zu finden. Und dann die Geburt. Niemand hat eine Ahnung, was wir damals durchgemacht haben. Kein Wasser, keine Tücher, nix. Diese Szene auf den Abziehbildern und dieses ganze Krippenbrimborium ist doch völliger Quatsch. Wir saßen absolut in der Tinte. Gott sei Dank bist du ja dann gekommen.“
„Ich?“
„Ja, natürlich. Ohne dich wäre der Kleine verhungert. Und Maria hätte sich niemals so schnell wieder erholt.“
Ich war heilfroh, als das Taxi endlich anhielt. Wenn nicht diese wunderbaren Gefühle und Lichter in Gegenwart der Beiden gewesen wäre, ganz ehrlich, ich hätte mich aus dem Staub gemacht. So schnell wie möglich, weg. Diese Geschichte war mehr als supergalaktisch, die war völlig durchgeknallt. Einige Male dachte ich an die versteckte Kamera.
Am Bahnhof angekommen, sprang ich rasch aus dem Taxi. Mein Bus wartete bereits an der Haltestelle.
Jo riss die Taxitür noch einmal auf.
„Um fünf, Theresa, um Fünf im Havanna.“
Ich winkte zurück und rannte zum Bus, der mich gerade noch so aufnahm.
Meine Mitschüler begrüßten mich mürrisch und ich verzog mich in die Ecke der hinteren Bank.
Hier fiel ich in eine Art Halbschlaf, in dem mir Marias Gesicht erschien, so wie ich sie in Lourdes gesehen hatte. Sie lächelte mir zu und mit einem Mal wusste ich woher ich die alte Frau aus dem Buchladen kannte.
„Anna“, dachte ich, „Anna, du warst das.“
Und obwohl ich mit Religion und all dem Kram echt nichts am Hut habe und ich Kirchen nur von außen kenne, kam das Deja-vu der Heiligen Zeit wie ein Flashback über mich und mit ihm ein abgrundtiefes, grenzenloses Vertrauen.
Zuhause zog ich mir erst einmal eine Stunde Techno rein. Aber auch das half nichts.
Meine Mutter zuckte nur mit den Schultern, als ich mich zwei Stunden später noch einmal Richtung Stadt aufmachte. Ich war sehr erleichtert, dass sie nicht nachfragte. Was hätte ich ihr auch erzählen sollen, ohne sie anzulügen.
Maria und Jo warteten bereits in einer kleinen Sitznische im „Havanna“.
Die Freude uns wiederzusehen war so innig, als hätten wir uns hundert Jahre nicht gesehen. Na, ja stimmte ja irgendwie auch.
Ich saß kaum, da kam auch schon der Kellner.
Jo bestellte ein Bier und ich tat es ihm gleich, denn ehrlich, nach so einem Tag kann man ein wenig Alkohol ganz gut gebrauchen.
Maria zauderte und fragte dann nach einem Wasser, einem einfachen Wasser ohne Kohlensäure oder Schnickschnack.
Mir wurde etwas mulmig und ich wusste, dass dies ein Moment war, so ein Moment, der dich verändert, der dir die Beine unterm Hintern wegzieht, dich in eine andere Umlaufbahn katapultiert.
Unsere Blicke trafen sich und das Licht um sie herum verdichtete sich ins Bläuliche.
Sie lachte und kuschelte sich in Jo`s Arme.
„Tja“, sagte Jo und zwinkerte mir zu, „wie beim letzten Mal, Theresa, wurde auch ich vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Engel des Herren, du weißt. Aber hier, in dieser Stadt! Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Wie gut, dass wir dich endlich gefunden haben.“
Maria lächelte.
In ihren Augen schimmerte ein Meer aus Vertrauen und Liebe.
Und mit einem Mal war alles wieder da.
Das Haus in Bethlehem, der Verschlag mit dem schalen Licht, die Unruhe der Tiere und die Ecke in meinem Haus, in der ich Zeichen auf Pergament malte, damit nicht vergessen wurde, was ich erlebt hatte mit den Beiden und dem Kind.
Mit einem Mal erkannte ich meine Aufgabe, erkannte den Grund, warum ich seit den Tagen in Lourdes das seltsame Tagebuch tagtäglich mit mir herumschleppte.
Ich sah und ich wusste und hatte doch keine Ahnung, wie ich das meiner Mutter erklären sollte.